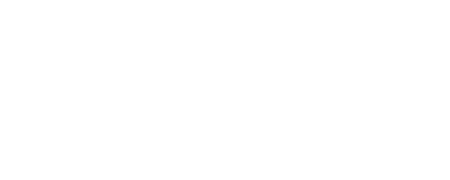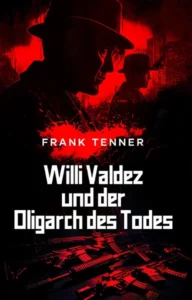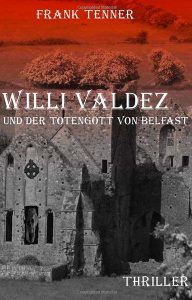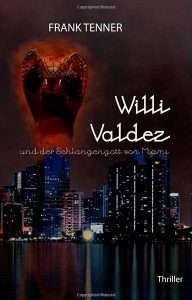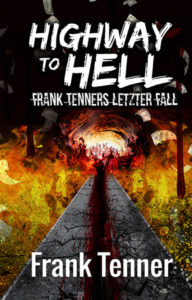Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss.
Frank Tenner (könnte auch von John Wayne stammen)
Prolog
Ich spürte auf schmerzhafte Weise, dass meine Lebenszeit sich dem Ende zuneigte. Aber verdammt, ich wollte noch nicht sterben. Nicht heute. Nicht auf diese Weise. Mir blieben vielleicht noch wenige Minuten. Dann würde ich ersticken. Oder ich könnte den Mund öffnen und einfach ertrinken. Obwohl ich irgendwo gelesen hatte, dass dies technisch nicht möglich sei. Ertrinken sei nur eine Unterform des Erstickens. Aber diese anatomisch-medizinische Weisheit war kein wirklicher Trost. Drei Minuten oder länger, mein Zeitgefühl hatte ich bereits verloren, hielt der Killer mich schon unter Wasser. Während der ersten vierzig oder fünfzig Sekunden, vielleicht waren es auch sechzig, ich konnte nicht auf meine Armbanduhr schauen oder die Sekunden mitzählen, hatte ich vorgegeben, um mein Leben zu kämpfen. Aber ich hatte nur zum Schein gestrampelt und getreten. Der Kerl war einfach zu groß und zu stark. Ich konnte mich aus dieser Position nicht befreien. Meine einzige Chance bestand darin, solange auszuhalten, bis der Killer mich für tot hielt. Vielleicht könnte ich dann zum Gegenangriff übergehen, falls ich dann noch die Kraft dazu aufbringen würde.
Die Natur hatte mich sicher nicht mit überdurchschnittlicher Intelligenz gesegnet, sonst wäre ich nie freiwillig Detektiv geworden und in solch eine aussichtslose Situation geraten.
Bis auf meine Armkraft, die ich mir in über vierzig Jahren hart erarbeitet hatte, verfügte ich auch nicht über außergewöhnliche körperliche Fähigkeiten. Mit einer entscheidenden Ausnahme: mein Lungenvolumen lag über dem Durchschnitt. Wer immer auch dafür verantwortlich zeichnete, das Schicksal, die Natur oder der Schöpfer, ich war dankbar für diese angeborene Gabe, weil sie mir als Junge beim Tauchen im Schwimmunterricht so manche Bestnote und bei den Mädchen bewundernde Blicke eingebracht hatte. Und jetzt gab sie mir den Hauch einer Chance zu überleben.
Aber auch der Sauerstoff der größten und trainiertesten Lunge des besten Apnoetauchers war einmal aufgebraucht, und die Todesangst führte nicht gerade dazu, dass ich besonders wenig von den lebensnotwendigen Bläschen verbrauchte. Ich hatte nie Yoga betrieben und kannte auch keine buddhistischen Zen-Techniken, aber ich musste versuchen, meinen Körper meinem Geist unterzuordnen. Dies war bloßes Wunschdenken, denn dieser Geist hatte genug mit sich selbst zu tun. Ich konnte langsam bunte Bilder tanzen sehen. Es fehlte bloß noch der so oft beschriebene Tunnel mit dem weißen Licht am Ende. Warum hatte ich nicht einfach in meinem Apartment bleiben und White, meinem Lieblingswaschbären, im frühen Sonnenlicht beim Spielen zusehen können? Es gab Menschen, die mussten, um ihren Lebensunterhalt verdienen zu können, tun, was sie taten. Aber ich? Mein Gehirn musste schon vor Wochen mit Sauerstoff unterversorgt gewesen sein, sonst wäre ich nie in diese Lage und mit dem Kopf und dem Oberkörper in diese Badewanne gelangt.
Ein Spruch, den ich in einem historischen Abenteuerfilm vom Titelhelden gehört hatte, kam mir in dieser Sekunde in den Sinn: Wenn der Tod dich anlächelt, kannst du nichts tun, als zurückzulächeln.
Mir war zum Erbrechen, zum Platzen, zum Verzweifeln, aber nicht zum Lächeln zumute. Was gab es doch für dumme Sprüche ohne Realitätsbezug. Der Tod war nur mit voll aufgedrehter Morphiumpumpe zu ertragen. Ich musste alle Willenskraft aufbringen, um nicht durchzudrehen und wieder mit dem sinnlosen Strampeln zu beginnen. Ich konzentrierte mich. Der Weltrekord im Apnoetauchen lag, wie ich gelesen hatte, bei über elf Minuten. Mir blieb also, auch ohne das Training eines Extremsportlers absolviert zu haben, noch alle Zeit der Welt. Dem Killer musste es doch allmählich langweilig werden.
Er würde den leblosen Körper früher oder später auf den Boden gleiten lassen. Früher oder später. Ich betete für das „früher“. Vielleicht konnte ich mich ablenken und die Sekunden gewinnen, die ausreichen würden, um diesen Gorilla zur Strecke zu bringen.
Und vielleicht würde ich den Fehler entdecken, der mich in diese Situation gebracht hatte. Irgendetwas hatte ich bei dieser ganzen Entführungsgeschichte übersehen.
Die letzten Tage begannen, wie ein Film im Zeitraffertempo vor meinem geistigen Auge abzulaufen. Ich wurde ganz ruhig und gab mich den Bildern hin.
Prolog Ende
1
Ich war kein Weichei mehr. Ich war ein harter Bursche geworden. Vor allem aber ein fauler.
Ich genoss die Sonne Floridas. Und die seit einigen Wochen wieder auftretenden Gewitter und gelegentlichen Schauer am Mittag genoss ich noch mehr. Denn in diesen Stunden lag ich mit Joanne im Bett und fühlte mich wie in biologisch besseren, weil jüngeren Jahren.
……………………………………….
18
Ich war in einem Kino gelandet. Skurrile Bilder begannen vor meinen Augen zu tanzen. Figuren wie aus einem surrealistischen Disney-Animationsfilm begannen ihr Spiel. Donald Duck hatte einen Schnabel, der größer war als sein gesamter Körper, Bugs Bunny trug eine Löwenmähne und fletschte seine Zähne und rannte blitzschnell im Kreis um mich herum. Goofy stelzte auf Beinen, die so hoch wie ein Wolkenkratzer waren. Alle Figuren gaben eigenartige Geräusche von sich und brüllten: Du wirst sterben! Du wirst sterben! Dann vermischten sich die Figuren und der schwarz flimmernde Hintergrund zu einem farbigen Brei, der mich zu ersticken drohte. Ich schloss den Mund, um die eklige Masse nicht schlucken zu müssen. Ein penetranter Geruch drang mir bis in die letzten Zellen meines Gehirns. Es stank nach verfaultem Fisch und Exkrementen. Ich spuckte die widerliche Flüssigkeit aus. Langsam kam ich wieder in die Welt zurück, die nicht weniger surreal war als mein Albtraum. Der Boden bebte und vibrierte, das Motorengeräusch übertrug sich über den Boden des Schiffes und ließ meinen in einer Pfütze liegenden Kopf mitvibrieren. Als ich meine Augen öffnete, sah ich zunächst nur schwarz. Nachdem sich meine Augen an das Dunkel gewöhnt hatten, wurden die Umrisse eines kleinen, abgetrennten Fischkopfes sichtbar. Seine Augen waren geöffnet und wirkten wie aus Glas. Die Pfütze, in der ich lag, verursachte den unangenehmen Geruch, den ich während meines erzwungenen Schlafes wahrgenommen hatte. Blut, Fischabfälle und Kot vermischten sich zu einer einzigartigen Geruchskreation. Ich musste würgen und hätte der Brühe beinahe eine ganz besondere Note hinzugefügt. Zwischen dem Dröhnen des Schiffsmotors hörte ich jetzt spanische Wortfetzen. Ich versuchte als Erstes, meine Hände zu bewegen, die straff auf dem Rücken mit dem Plastikband zusammengebunden waren. Ich hatte noch Gefühl in den Fingern, ich konnte sie zur Faust ballen. Dann drehte ich meinen Körper und Kopf zur Seite und vermochte mit einem Auge die Sterne am Himmel zu sehen. Jetzt kam die Erinnerung vollständig zurück. Die Motorengeräusche verstummten. Das Boot lag ruhig, es schien keinen Seegang in dieser Nacht zu geben. Ich wurde grob nach oben gezogen und auf die Seitenbank gesetzt. Ich spannte meine Knöchel. Ich spürte sofort, dass das dünne Seil nicht ohne Hilfsmittel zu lösen war. In gebrochenem Englisch meinte eine leicht quäkende Stimme: „Amigo! Aufwachen! Wir sind da. Das Ziel ist erreicht. Du sollst doch das Beste nicht verpassen.“
Ich schaute in das, selbst im Halbdunkel noch rötlich glänzende, vom ständigen Alkoholgenuss aufgedunsene Gesicht mit den Schweinsäuglein des dicklichen Leibwächters von Moreno.
Sein nur wenig kleinerer und ebenfalls zur Fettleibigkeit neigender Kumpan bückte sich und tauchte einen Lappen in einen Eimer. Dann kam er auf mich zu und schmierte die blutige Brühe an mein Hemd und die Hosenbeine. Er überlegte einige Sekunden, bis ihm ein besonders guter Einfall kam. Er zückte ein Taschenmesser und öffnete die Knöpfe des oberen Teiles meines Hemdes und machte einen kleinen Schnitt direkt in die Brust. Der Schnitt war nicht tief und auch nicht sehr schmerzhaft, aber ausreichend, um einen kleinen Teil meines Blutes aus der ursprünglichen Bahn zu leiten. Beim Öffnen des Hemdes hatte Luis meinen Talisman entdeckt, eine schmale goldene Kette mit einem kleinen Herzen als Anhänger. Joanne hatte sie mir zu Weihnachten geschenkt. Die Kette sollte mir Glück bringen. Davon war ich im Augenblick weit entfernt. Mit einem Ruck riss der Typ, den sein Boss in meiner Gegenwart Luis genannt hatte, die Kette von meinem Hals und schaute sie sich im Mondschein an. „Hör zu, Luis. Die Kette ist nicht viel wert. Aber sie ist ein Andenken. Bitte nimm sie mir nicht weg. Wenn ich sterben muss, will ich sie bei mir haben.“
Der Angesprochene lachte. „Du wirst auch ohne die Kette sterben. Ich schenke sie heute Nacht meiner kleinen Garcia. Die wird sich freuen und mir zum Dank einen blasen.“
„Deine Hasenscharte vergesse ich nicht, Luis. Deine Freundin wird die Kette nicht lange tragen können.“
Er wollte gerade antworten, aber sein Kumpan meinte wütend: „Komm, mach hin, Luis. Ich will endlich Feierabend haben und in Ruhe einen trinken.“
„Schon gut, Hugo. Ich bin fertig.“
Er steckte die Kette in seine Hosentasche und zog mich von meinem Sitz hoch. Bevor mich die beiden über Bord warfen, lachten sie laut und der Kerl mit der Hasenscharte kopierte Arnold Schwarzenegger in seiner Rolle als Terminator: „Hasta la Vista, Baby!“
Der Größere wollte wohl seinem Kumpan nicht nachstehen und seine Kreativität beweisen, er gab mir einen fröhlichen Gruß mit auf meinen letzten Weg. „Grüß die Haie, Amigo!“
Als das dunkle Wasser über mir zusammenschlug, spürte ich keine Todesangst, die hatte ich noch wenige Sekunden zuvor gehabt. Ich war davon ausgegangen, dass die beiden Killer mir vor dem Versenken im Ozean noch einige Kugeln in den Hinterkopf schießen würden. Obwohl dies gegen Morenos philosophische Hinrichtungsmethode verstoßen hätte.
Jetzt fühlte ich mich in meinem Element. Vielleicht war ich in einem früheren Leben ein Meerestier gewesen oder zumindest ein Säugetier, das sich viel im Wasser aufhielt. Ein Nilpferd zum Beispiel. Besser ein Delfin, der war graziler und schneller. Wie auch immer, das Schicksal räumte mir offensichtlich noch eine Chance ein. Das Motorboot entfernte sich schnell, die beiden Killer hatten wohl kein besonderes Interesse daran, meinen Todeskampf bis zum Versinken zu beobachten. Für die Männer Morenos war die Arbeit getan, sie dachten vielleicht schon an die Señoritas im Café Havanna und einige gute Drinks als Animation. Die Kleidungstücke, vor allem die Schuhe und das schwere Hemd zogen mich in die Tiefe, das Strampeln mit den Füßen würde ich nur wenige Minuten durchhalten können, zumal ich bereits zweimal das salzige Wasser geschluckt hatte. Ich musste die Arme freibekommen, sonst nützte mir auch mein geliebtes Urelement nichts. Dreimal atmete ich tief durch, dann füllte ich mit einem langen Zug meine Lungen und ließ mich unter die Wasseroberfläche sinken. Mit den gefesselten Händen erreichte ich ohne Mühe die Absätze. Dass im rechten Absatz eingebaute kurze Messer sprang normalerweise heraus, wenn man den Fuß leicht anhob und den Absatz kräftig nach rechts verschob. Hier gab es keinen Boden, auf dem ich stehen und die notwendige Bewegung hätte ausführen können.
Ich versuchte daher, den Absatz per Hand zu drehen. Zweimal rutschte ich ab. Ich bot alle Kraft meiner Finger in der rechten Hand auf und hätte fast den Absatz abgerissen, mein Körper muss wie eine unförmige, sich drehende Kugel mit Kopf und angezogenen Beinen ausgesehen haben.
Wenn ein Taucher mit einer Unterwasserkamera mich in diesem Augenblick gefilmt hätte, wäre dies sicher ein erfolgreiches Kurzvideo bei You Tube geworden. Menschen lieben es, andere in Todesgefahr zu sehen, zumal wenn die Sache auch noch komisch anzuschauen ist und ein Happy End hat. Das Happy End bestand darin, dass ich zumindest einen Zentimeter der Klinge nach außen gedrückt hatte. Nachdem ich mich nach oben gestrampelt und einige Male Luft geschnappt hatte, begann der Versuch, die Handfessel zu zerschneiden. Das Seil war stabil und fest verknotet und die Klinge etwas kurz, aber mit einiger Geduld und noch zweimaligem Auftauchen und Luftholen gelang mir der entscheidende Schnitt. Ein zweites Mal in kurzer Zeit rettete mir diese Klinge das Leben. Als ich beide Arme ausstrecken und Schwimmbewegungen machen konnte, fühlte ich mich wie ein Gefangener, der aus dem dunklen Kerker ins Licht der Freiheit entlassen wird. Das mit dem Licht stimmte nur bedingt. Es war eine klare Nacht, die Sichel des Halbmondes am Himmel war zu sehen und einige Sterne. Aber das Wort Licht war doch reichlich übertrieben. Kurz darauf sah ich eine andere Sichel. Besser eine scharfe, unverwechselbare Flosse. Keine zwanzig Meter von mir entfernt. Jetzt verstand ich den Sinn der Redewendung „Mir blieb fast das Herz stehen“. Die Todesangst vor wenigen Minuten war nichts im Vergleich zu dem Gefühl, das sich jetzt meiner bemächtigte. Es muss sich um die Urangst des Menschen vor dem Gefressenwerden gehandelt haben. Beim Tauchen hatte ich hin und wieder vor Key West harmlose Ammenhaie beobachtet und in der Ferne auch mal einige nicht ungefährliche, zum Glück nicht allzu große Schwarzspitzenhaie gesehen und einmal sogar aus zehn oder zwanzig Meter Abstand vor mein Unterwasserobjektiv bekommen, aber es war helllichter, sonniger Tag, das Wasser glasklar und ich war Mitglied einer Tauchergruppe und der erfahrene Tauchlehrer hatte eine Harpune dabei. Aber dies hier war ein schwarzer Albtraum. Ich überlegte krampfhaft, welche Haiarten in diesem Teil der Karibik verbreitet waren und was uns der Tauchlehrer über das Verhalten von Haien erzählt hatte. Sie hätten einen unglaublich guten Geruchssinn und würden ihre Beute auf große Entfernungen wahrnehmen. Aber auch die anderen Sinnesorgane seien alles andere als unterentwickelt. Mir wurde klar, dass mich mein Gestrampel in Synthese mit dem Fisch- und Blutgeruch meiner Kleidung zu einem Beutetier gemacht hatten.
Ich riss mir die Schuhe von den Füßen, dann das Zweitausend-Dollar-Hemd und die Hose vom Körper. Mit der Hose verschwand auch das inzwischen wahrscheinlich ohnehin nutzlos gewordene Beweisstück, das ich in der Lagerhalle gesichert hatte. Mit ruhigen Schwimmstößen entfernte ich mich von den nun im Wasser treibenden Kleidungsstücken. Der Hai schien zum Glück nicht größer als anderthalb Meter zu sein und ich sah keine weiteren scharfen Flossen aus dem Wasser ragen. Er schwamm mit seinem Maul gegen mein langsam versinkendes Spezialhemd und zog es einige Meter mit sich fort. Dann kreiste er einige Male um mich herum. Ich schien ihm als Beute wohl etwas groß geraten zu sein. Nach einer halben Minute verschwand die Flosse im sich leicht bewegenden schwarzen Wasser. Vielleicht wollte er Verstärkung holen. Vielleicht hatte er aber auch das Interesse verloren und schon seine Abendmahlzeit gehalten, die Gewässer an dieser Küste galten als sehr fischreich. Ich beruhigte meinen Atem und schaute mich um. In riesiger Entfernung sah ich die kleinen Lichter eines Ozeanriesen, wahrscheinlich eines der Kreuzfahrtschiffe, die im Hafen von Cartagena für vierundzwanzig Stunden ankerten. Sie boten den Passagieren für viel Geld die Möglichkeit, in einer drei- oder vierstündigen Kurztour die koloniale Altstadt mit der Plaza de Bolivar und einige andere Sehenswürdigkeiten der karibisch geprägten Stadt kennenzulernen, bevor sie schon wieder ausliefen und weiter nach Panama oder Venezuela fuhren. Die Hafenlichter und die Lichter auf der alten Festung waren als winzige flackernde Pünktchen zu erkennen.
Ich war dank des täglichen Schwimmtrainings in guter körperlicher Verfassung, aber ich machte mir keine Illusionen, selbst wenn ich täglich die doppelte Übungsstrecke zurückgelegt hätte, ohne Hilfsmittel war die Küste nicht erreichbar. Es war eine existenzielle Erfahrung. Jeder Philosoph, der sich anschickte, über das Sein und das Nichts, die Verlorenheit und den Tod zu schreiben, sollte in klarer Nacht einige Kilometer auf den Pazifik oder den Atlantik hinausschwimmen und dann zum Sternenhimmel und in die scheinbar unendliche Weite des Ozeans schauen. Die dichten Wolken hatten sich verzogen und gaben den Blick frei auf ein atemberaubendes Naturschauspiel. In einer einzigen Sekunde wurde einem die wirkliche Bedeutung und Größe, besser die Winzigkeit des Menschen bewusst. Ein Nanopunkt in der Unendlichkeit. Ein fast heiliger Schauer durchfuhr meinen gesamten Körper und das, was man meist als Seele bezeichnet. Noch nie hatte ich mich so klein, so absolut nichtig gefühlt. Nicht Angst vor dem Unvermeidlichen, sondern eine tiefe Demut bemächtigte sich meiner. Dazu ein Fatalismus, der mir in früheren Jahren gefehlt hatte. Mir fiel ein Spruch aus einem arabischen Märchen ein: Der Weg, auf dem du deinem Schicksal entfliehen willst, ist genau der Weg, auf dem es dich erwartet. Es gab schlimmere Todesarten, als allmählich im Meer zu versinken und zum Anfang des Seins oder aber einfach nur in die Nahrungskette von Mutter Natur zurückzukehren.
…